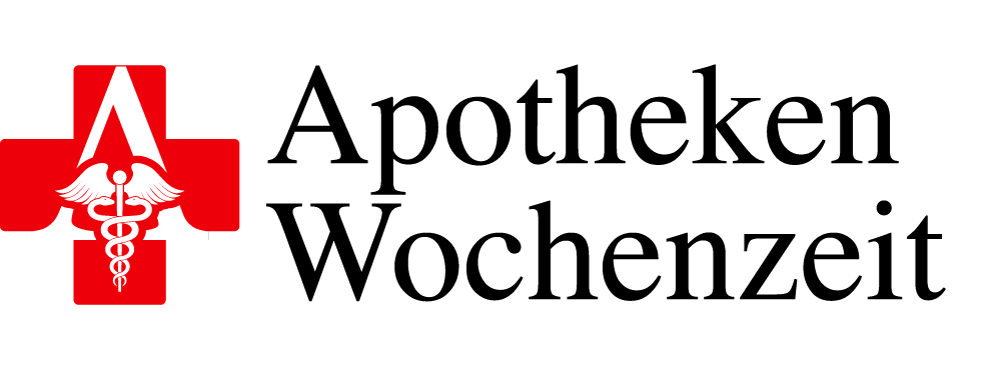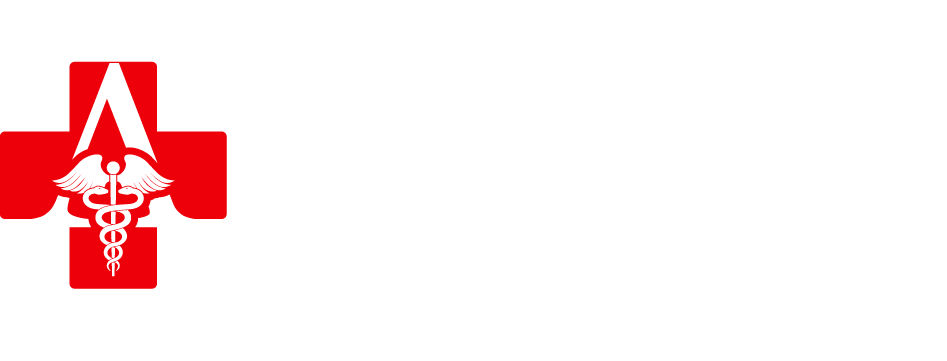Ob Physiotherapie, Ergotherapie oder Sprachtherapie – viele dieser Maßnahmen gehören zu den sogenannten Heilmitteln. Doch ohne eine entsprechende Heilmittelverordnung lassen sich solche Therapien in der Regel nicht über die gesetzliche Krankenversicherung abrechnen. Für viele Patienten wirft das Fragen auf: Was genau regelt eine Heilmittelverordnung, wer stellt sie aus – und welche Bedeutung hat sie für den Behandlungserfolg?
Was eine Heilmittelverordnung ist – Definition und Zweck
Die Heilmittelverordnung ist ein ärztliches Formular und bildet die Grundlage für bestimmte therapeutische Leistungen. Sie gilt als offizieller Behandlungsauftrag: Ein Arzt verordnet gezielte Maßnahmen zur Wiederherstellung, Verbesserung oder Erhaltung der Gesundheit.
Typische Anwendungsbeispiele:
- Krankengymnastik zur Mobilisation nach Operationen
- Ergotherapie bei motorischen oder kognitiven Einschränkungen
- Logopädie bei Sprach-, Sprech- oder Schluckstörungen
Für die Verordnung wird das Formular Muster 13 verwendet. Darauf werden Art, Umfang und Dauer der Maßnahme eingetragen. Nur mit dieser Verordnung kann eine therapeutische Praxis die Leistungen mit der Krankenkasse abrechnen.
Was eine Verordnung therapeutischer Maßnahmen umfasst
Nicht jede medizinische Maßnahme fällt unter den Begriff Heilmittel. Nur solche Behandlungen, die eine konkrete Störung beheben oder lindern sollen und eine ärztliche Therapie ergänzen, sind über die Heilmittelverordnung abrechnungsfähig.
Dazu zählen insbesondere:
- Physikalische Therapie (z. B. Massagen, Wärmebehandlungen, Elektrotherapie)
- Physiotherapie (z. B. manuelle Therapie, Bewegungstherapie)
- Sprach- und Schlucktherapie
- Ergotherapie (z. B. bei neurologischen Erkrankungen)
- Podologische Therapie (z. B. beim diabetischen Fußsyndrom)
Nicht eingeschlossen sind Hilfsmittel wie Rollatoren, Bandagen oder Hörgeräte. Sie werden über andere Verordnungswege abgedeckt.
Ablauf: Von der Diagnose zur Heilmittelverordnung
Der Weg zur Heilmittelverordnung beginnt mit einer ärztlichen Untersuchung. Liegt eine Diagnose mit therapeutischer Relevanz vor – etwa ein Sprachverlust nach Schlaganfall oder chronische Rückenschmerzen – kann der Arzt ein Heilmittel verordnen.
Auf der Verordnung stehen:
- die exakte Diagnose (ICD-Code)
- die verordnete Maßnahme
- Anzahl und Häufigkeit der Einheiten
- Ziel der Therapie (z. B. Schmerzlinderung, Bewegungsverbesserung)
- falls notwendig: Hausbesuch oder dringlicher Behandlungsbeginn
Der Patient reicht das Formular bei der gewählten Praxis ein. Ist alles korrekt ausgefüllt, erfolgt die Genehmigung durch die Krankenkasse meist automatisch. Die Behandlung kann dann beginnen.
Gültigkeit und Fristen
Eine Heilmittelverordnung ist nicht unbegrenzt gültig. Ab dem Ausstellungsdatum bleiben 28 Kalendertage, um mit der Therapie zu starten. Erfolgt der Beginn nicht rechtzeitig, verliert die Verordnung ihre Gültigkeit und muss neu ausgestellt werden.
Ausnahme: Ist ein dringlicher Behandlungsbeginn angekreuzt, reduziert sich die Frist auf 14 Tage.
Außerdem darf die Therapie nach dem Start nicht länger als 14 Tage unterbrochen werden. Sonst ist ebenfalls eine neue Verordnung erforderlich. Deshalb sollte man alle Termine frühzeitig mit der Praxis abstimmen – besonders bei knappem Therapieangebot.
Wer eine Heilmittelverordnung ausstellen darf
Alle niedergelassenen Vertragsärzte dürfen Heilmittel verordnen. Je nach Fachrichtung sind das zum Beispiel:
- Hausärzte
- Orthopäden (z. B. bei chronischen Rückenleiden)
- Neurologen (z. B. nach Schlaganfällen)
- HNO-Ärzte oder Kinderärzte (z. B. bei Sprachstörungen)
Wichtig: Für Heilmittelverordnungen gelten bestimmte Richtgrößen. Überschreitungen können zu Wirtschaftlichkeitsprüfungen führen – selbst wenn sie medizinisch gerechtfertigt sind.
Sonderregelungen
Einige Patientengruppen profitieren von erweiterten Verordnungsmöglichkeiten, zum Beispiel:
- Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder Sprachstörungen
- Personen mit chronischen Erkrankungen wie Parkinson oder Multipler Sklerose
- Pflegebedürftige, die Hausbesuche benötigen
In solchen Fällen kann die Therapie außerhalb der Regelfallsystematik erfolgen – mit mehr Einheiten oder über einen längeren Zeitraum. Auch bei postoperativen Behandlungen, neurologischen Erkrankungen oder in der Geriatrie sind Ausnahmen möglich.
Fazit: Die Heilmittelverordnung als Einstieg in die Therapie
Die Heilmittelverordnung ermöglicht eine medizinisch sinnvolle, strukturierte und finanzierbare Therapie. Sie definiert den Umfang der Behandlung und bildet die Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen Arzt, Therapeut und Patient. Wer den Ablauf kennt und die Fristen beachtet, verbessert die Erfolgschancen der Behandlung – einfach, nachvollziehbar und geregelt.